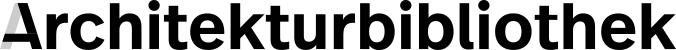Die Berner Bruder Klaus Kirche ist Teil einer Reihe von katholischen Kirchenbauten Hermann Baurs. Sie zeugt von den Diskussionen der frühen 1950er Jahre in der Schweiz, wie Sakralräume zu gestalten seien. Die Architekten jener Zeit strebten Baukörper an, die den komplexen Bauaufgaben und -programmen gerecht werden und durch Verbindungsbauten als Gebäudekomplex erscheinen sollten. Der Berner Bau nimmt das Thema des bewegten Kirchenraums weniger stark auf als in Baurs Basler Kirchen.
Chronologie
1938 erwarb die Kirchgemeinde Bern ein Eckgrundstück im Ostring von der Burgergemeinde Bern, um dort die Bruder-Klaus-Kirche zu errichten. Erst 1951 wurde jedoch ein Wettbewerb ausgeschrieben, den Hermann Baur mit seinem Projekt gewann, das ein eher kleines Volumen und geringe Kosten auszeichnete. Nach den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden der Altarraum und die Unterkirche in den 1970er Jahren umgebaut. 1986 wurde der Freiraum zwischen Kirche und Gemeindehaus mit zusätzlichen Räumen und einer neuen Erschliessung ergänzt. Eine weitere Umgestaltung des Altarraums fand von 1993 bis 1994 statt.
Lage
Die Bruder-Klaus-Kirche im Osten von Bern gehört zum Schlosshalde-Quartier. Das Grundstück befindet sich an einer stark befahrenen Kreuzung bei der Tramhaltestelle Burgernziel. Es grenzt im Südosten an den Ostring, im Nordosten an die Segantinistrasse und im Südwesten an die Muristrasse. Die Erschliessung der Kirche erfolgt über den Hauptzugang, der zur Kreuzung hin ausgerichtet ist. Der Aussenbereich ist durch grosszügige Grünflächen gestaltet. Parkplätze sind über die Segantinistrasse erschlossen.
Beschreibung
Im Zentrum der Anlage steht das Kirchengebäude aus Beton mit seiner hohen, sich trapezartig verjüngenden Grundform. Die Front mit der zentralen Fensterrose wendet sich zur Kreuzung, doch ist der Vorplatz etwas angehoben und mit einem Grüngürtel optisch von der Umgebung getrennt. Die Ostseite wird vom Pfarrhof, die Nordwestseite vom Kirchgemeindeplatz flankiert. Die Volumetrie reagiert auf die örtlichen Gegebenheiten. Die Höhenentwicklung des präzise gesetzten Hauptbaus reagiert auf die angrenzenden Mehrfamilienhäuser. Die deutlich sichtbare Primärkonstruktion besteht aus einem Ortbetonskelett und Dachträgern aus vorgespanntem Stahlbeton. Die sekundären Elemente der Ausfachungen wirken klar als Füllung. Die Ausfachungen wurden mittels Kalksandsteinen oder mit Betonelementen erstellt. Die Betonelemente enthalten kleine Verglasungen, die eine Verbindung zwischen Aussen und Innen zulassen. Die Dachstirnen mit ihren grossen Auskragungen und dem nutartigen Abschluss runden die Gestaltung des Gebäudes ab. Der in Randlage platzierte schlanke Kirchturm steht im Kontrast zum Hauptbau und wirkt Richtung Kreuzung als Zeichen. Die zum Quartier gewendeten Fassaden sind verputzt und zeigen die rohen Materialien nicht.
Der Haupteingang ist über einen filigranen Windfang mit dem Vorplatz verbunden. Von hier gelangen die Besucher in eine niedrige Zone unter der Empore. Die Empore selbst wird von einer frei schwingenden Wendeltreppe mit Plattenstufen erschlossen. Der Innenraum ist von gedämpftem Licht aus gitterartigen Wandöffnungen geprägt, während der Altar durch ein Oberlicht stärker erhellt wird. Abends wird diese Stimmung mit Tiefstrahlleuchten erzielt. Die Anordnung der Bänke konzentriert die Aufmerksamkeit zum Altar hin. Der ihn umgebende Raum ist durch Stufen und wechselnden Bodenbelag etwas abgesetzt. Die Tragstruktur ist auch im Innern ablesbar. Einen warmen Kontrast bieten das Holz der Bänke, der Orgel und der Eingangstüren. Der mit Natursteinplatten belegte Boden reflektiert das Licht in den Raum.
Literatur
- Furrer, Bernhard. Die Kirche Bruder Klaus in Bern, Bern 2000