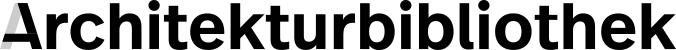Mit dem Werkhofkomplex der EWA beziehungsweise der Neuinterpretation der traditionellen Bauten und Bauensembles im Ortskern von Altdorf leisteten die drei jungen H2S Architekten einen wichtigen Beitrag zur modernen Urner Architektur. Auch die Bepflanzung nimmt auf den parkähnlichen Charakter der historischen Aussenräume Bezug.
Cronologia
Dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes, der Lager- und der Einstellhalle des Elektrizitätswerks Altdorf (EWA) in den Jahren 1995 bis 1998, ging 1994 ein Wettbewerb voraus. Beauftragt wurden die Gewinner H2S Architekten. Das bestehende Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, das der EWA als Direktionsgebäude dient, wurde zeitgleich renoviert.
Contesto
Das EWA befindet sich am nördlichen Rand des historischen Ortskerns von Altdorf. Die dreieckig geformte Parzelle Eselmätteli wird von der Herrengasse, der Birken- und der Hagenstrasse begrenzt. Die Einfahrt liegt an der Herrengasse, der Hauptstrasse, die sich durch den Kantonshauptort schlängelt. Die Neubauten sind dem Herrenhaus Eselmätteli hierarchisch untergeordnet. Sie wurden als Ökonomiegebäude interpretiert und entsprechend dem Vorbild der benachbarten Anwesen an die Parzellengrenze gesetzt, das Grundstück anstelle einer Natursteinmauer mit einer Betonmauer eingefasst. Das dreigeschossige Verwaltungsgebäude steht am südlichen Rand der Parzelle, das Lager am westlichen und die Einstellhalle am nördlichen. Durch die Setzung der Gebäude entstand ein präzis gefasster Aussenraum, dem verschiedene Nutzungen zugeordnet wurden: Parkplatz, Werkhof, Gartenhof und Eingangshof. Der Parkplatz verbindet alle Gebäude. Seine Bepflanzung interpretiert die Themen Ziergarten und traditionelle Vorfahrt neu.
Descrizione
Die mit äusserst geringen Dachneigungen gedeckten Neubauten stehen in ihrer Konstruktion und Materialisierung in bewusstem Gegensatz zu den umgebenden, massiv konstruierten Patrizierhäusern. Die Untergeschosse sowie die Installations- und Erschliessungskerne sind in Beton ausgeführt. Das Bürogebäude ist in einer Betonskelettkonstruktion ausgeführt, die Tragstruktur etwas zurückversetzt. Die Lager- und die Einstellhalle sind aufgrund ihrer grossen Spannweiten und Raumhöhen in einer Stahlkonstruktion ausgebildet. Die Fassadenkonstruktion basiert auf einem Baukastensystem aus drei Elementen, welche den Bedürfnissen der jeweiligen Gebäude angepasst sind. Das erste Element sind Zweifachisoliergläser, das zweite doppelschaliges Industriegussglas (Profilit), das je nach Anforderung mit einer transluzenten Wärmedämmung aus Zellulose gefüllt ist, und das dritte gedämmte Aluminiumlüftungsflügel. Diese drei Elemente sind abwechselnd an den Fassaden angeordnet. Die markanten, grünlich schimmernden Oberflächen fassen die Trakte zu einer Einheit zusammen.
Durch die umlaufenden, raumhohen Verglasungen sind alle Innenräume mit Licht durchflutet. Die matten Glaspartien vermitteln dennoch ein Gefühl der Geborgenheit. In der inneren Erschliessung findet das Prinzip der Offenheit seine Fortsetzung, vor allem im Empfangsbereich und der Cafeteria im Erdgeschoss.
Bibliografia
Schweizer Heimatschutz (Hg.). Baukultur entdecken: Altdorf Wakkerpreis 2007. Zürich 2007, Nr. 8. – Werkhof Elektrizitätswerk Altdorf UR, in: Werk, Wohnen + Bauen 6/1999, S. 1–4 (Werkmaterial). – Omachen, Peter. Intuitives Generieren neuer Qualitäten. Arbeiten von Harder, Strub und Spreyermann, in: Neue Zürcher Zeitung 9.4.1999, S. 86. – Langer, Axel. Ein Industrieller unter lauter Patriziern. Die Neubauten des Elektrizitätswerkes Altdorf, in: Neue Zürcher Zeitung 6.11.1998, S. 75. – Omachen, Peter. Städtebau im Park, in: Archithese 4/1998, S. 58–63.